Wir kennen uns eigentlich gar nicht wirklich. Wir sind verabredet um berufliche Dinge zu besprechen. „Ich hab dich gegoogelt“, meinte sie schon beim Telefongespräch im Vorfeld. „Dein Blog… Ich hab auch ein Kind an Krebs verloren. An einem Hirntumor…“
Der Grund unseres Treffens war ein ganz anderer. Und doch war gleich Thema, was uns verbindet. Der Austausch schon vom ersten „Hallo“ an auf einer ganz anderen Ebene. Man spricht dieselbe Sprache, hat die gleiche Welt gesehen – eine Welt, die man noch so gut beschreiben kann, und die doch keiner versteht, der nicht irgendwann einmal Teil davon gewesen ist.
Wir sprechen über die Trauer, das Abgrenzen und die Studien, nach denen behandelt wurde. Über den Konflikt einer Mutter, mit den anderen Kindern daheim und mit dem einen in der Klinik. Wir sprechen über das Experimentieren mit Medikamenten, über Kinder, die zwar geheilt aber nie mehr wieder gesund sein werden, und darüber, was das mit dem Rest der Familie macht.
Und wir sprechen übers Alleinsein. „Ich hab mich einfach allein gefühlt“, sagt sie, als wir über die Zeit mit dem Kind in der Klinik sprechen. Auch in ihrer Familie lief für den Rest der Alltag weiter wie immer, trotz emotionalem Chaos – oder vielleicht gerade wegen diesem emotionalen Chaos. Kinder in der Schule, in der Kita, Papa auf der Arbeit. Diese Zeit habe ich fast komplett verdrängt, wird es mir kurz nach unserem Gespräch bewusst, und aus dieser Perspektive habe ich das alles noch nie gesehen. Mein Fokus war immer auf die Familie daheim gewesen, dass ich fast ein Jahr lang weg gewesen war von daheim, die Kinder allein. Mich selbst hatte ich in diesem Kontext noch nie so wirklich betrachtet.
„Ich hab mich einfach allein gefühlt“, sagt sie, und da kommen mir Bilder und Szenen aus dieser Zeit. Ich sehe mich alleine auf der Dachterrasse des Elternhauses sitzen, die Beine in eine Decke, den Pizzakarton auf dem Schoß. Erinnere mich an den Salat mit fertigem Balsamico-Dressing und die Spaghetti mit Pesto, die Asia-Suppe, die man nur mit kochendem Wasser übergießen musste. Wenn es mir nicht gut geht, ist kochen irgendwo ganz unten auf der Liste. An guten Tagen hab ich mir am Obst- und Gemüsestand vor der Klinik Trauben gekauft, nachher bei Edeka etwas Käse und ein Stück Brot dazu.
Manchmal saß man zur gleichen Zeit wie ein anderer in der Gemeinschaftsküche – da war man kurz mal nicht einsam. Morgens, wenn ich auf meinen Kaffee in die Küche kam, saß meistens auch Hugos Papa dort; wir kannten uns schon von der Station und das Gespräch war angenehm. Aber man konnte auch nicht mit jedem gleich gut, wollte auch nicht mit jedem zusammensitzen.
Einmal in der Woche wurde im Elternhaus mit unglaublich viel Hingabe und Liebe gekocht – damit man nicht so einsam wird, damit man reden kann, sich begegnen kann, sich versorgt fühlt, gesehen… Wer nicht dabei sein konnte, für den wurde etwas zurückgelegt.
Und doch war man allein. Keiner konnte mir abnehmen, was nun zu tragen war. Und manchmal hab ich mich bewusst für die Einsamkeit entschieden, weil ich wusste, dass diese Zeiten der Gemeinschaft zwar einen Moment der Leichtigkeit verschaffen konnten, aber doch nie die Kraft besaßen, mich von der Schwere zu befreien, die auf meinem Herzen und auf meinem Leben lag.
Ich habe Paare gesehen, von denen beide Elternteile gleichzeitig bei ihrem Kind sein konnten. Vielleicht waren sie nicht ganz so oft einsam, und doch war im Grunde jeder auf sich gestellt. Alleine, mit sich und seinen Gefühlen. Denn jeder verarbeitet anders, lenkt sich anders ab, trauert anders…
Wie hieß nochmal dieser Film? „Zusammen ist man weniger allein“. Ich liebe diesen Titel. An den Film kann ich mich kaum mehr erinnern. Doch der Titel fasst die Wahrheit kurz und knapp zusammen. Die Wahrheit über das Leben mit einem schwerkranken Kind, mit einem toten Kind (bestimmt auch die Wahrheit über ganz viele andere Lebenssituationen, aber die sind nicht mein „Fachgebiet“) – Man ist allein. Je nach Gesellschaft und Anschluss vielleicht mal weniger allein, nicht einsam. Doch allein ist und bleibt was es ist – egal ob mehr oder weniger. Allein ist und bleibt allein.

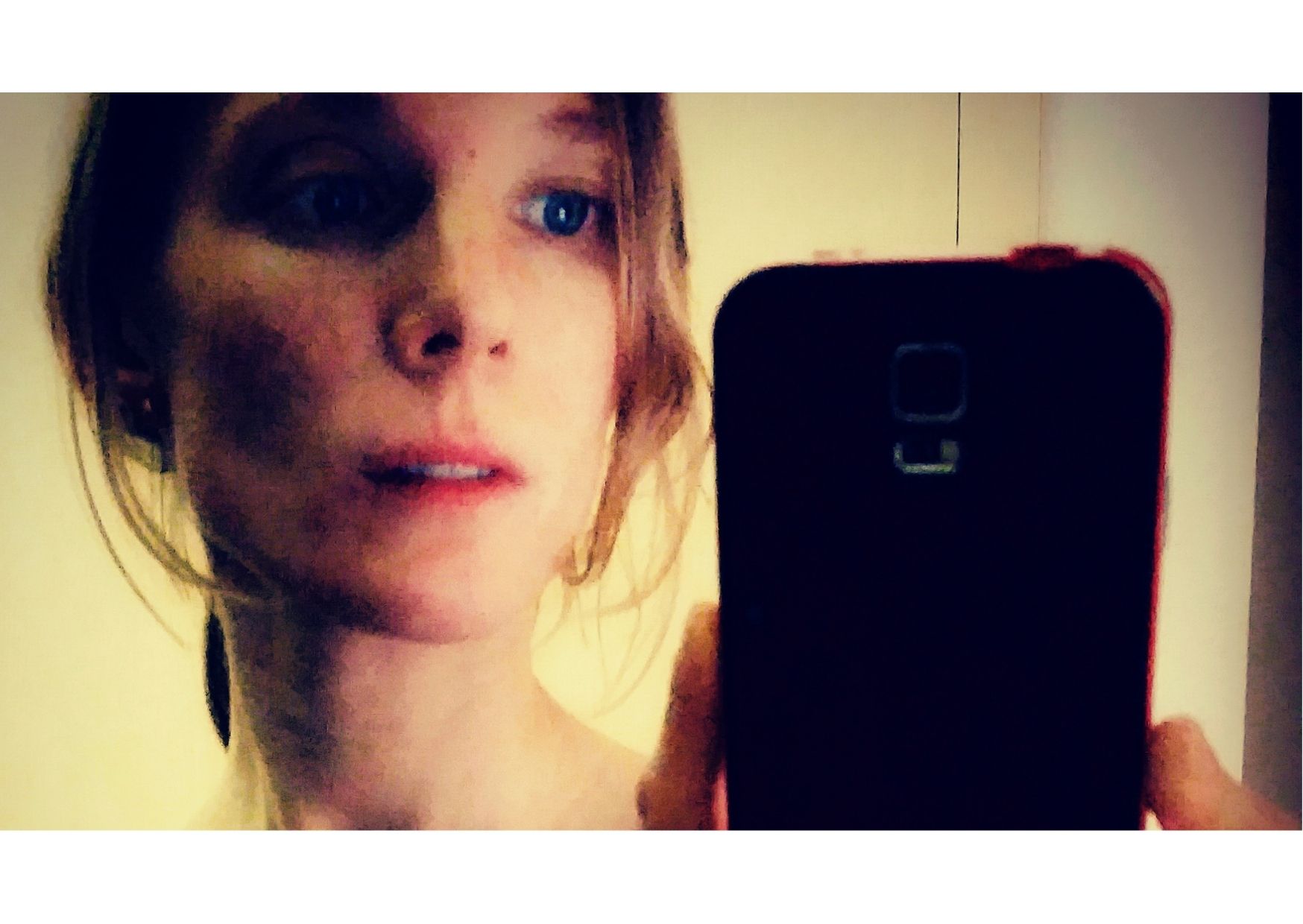
Liebe Julia. Ja, man ist allein. Man muss sich allein, mehr oder weniger aus eigener Kraft, aus fast eigenem Antrieb,callein auf diese Welt kämpfen. Und auch wenn beim Sterben die ganze Familie um einen rumstehen sollte. Den Schritt hinüber muss man auch ganz alleine tun.
Liebste Grüße, Barbara
Wie schön, von dir zu lesen <3 Ich hab Jona die letzten Tage vor seinem Tod immer gesagt "Da wird kein Tunnel sein durch den du alleine gehst." weil davor hatte er Angst... Ich hab ihm gesagt und geglaubt, und ich würde sagen auf die Art und Weise hat seine Seele dann auch diese Erde verlassen, "Du wirst abgeholt. Meine Hand lässt dich los und die nächste hält dich fest." Keine Ahnung, ob ich recht hab oder nicht... ich bin noch nie gestorben 😉 Nur ihm hat das Ruhe gegeben und mir hilft das heute noch, zu glauben, dass er keine Sekunde alleine war... Aber ich weiß und ich verstehe, was du meinst 🙂 Von Herzen liebe Grüße!